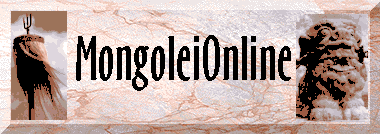Eröffnung der
Sondersitzung der Staatsversammlung verschoben
Die Sondersitzung der Großen
Staatsversammlung, die am 15.02., 09:00 Uhr, eröffnet werden sollte, fiel wegen
unzureichender Teilnehmerzahl aus.
Die MVP hatte die Notwendigkeit einer Sondersitzung sowieso bestritten.
Während der Herbstsitzungen seien elf von 24 Fragen diskutiert worden.
Am 04. April begännen die Frühjahrssitzungen.
Auf der zehntägigen Sondersitzung könnten nicht die 20 vorgesehenen
Gesetzentwürfe mit der nötigen Sorgfalt besprochen werden.
Außerdem halten wir die Abberufung der Mitglieder des Verfassungsgerichts – ein
Tagesordnungspunkt der Sondersitzung – für ungesetzlich.
Nein, sollte der MRVP-Vorsitzende zum stellvertretenden Ministerpräsidenten
ernannt werden, wären wir nicht dagegen, erklärte MVP-Fraktionsvorsitzender S.
Byambatsogt in einem Pressegespräch.
Im Übrigen seien 22 der 26 MVP-Abgeordneten an ihrem Arbeitsplatz im
Regierungspalast. Der Vorsitzende sollte eher dafür sorgen, dass die
DP-Abgeordneten in den Sitzungssaal kämen.
Abberufung des
Vorsitzenden des Verfassungsgerichts
Am 19. Februar stimmten 35 der 44
anwesenden Mitglieder der Staatsversammlung für die Abberufung des Vorsitzenden
des Verfassungsgerichts J. Amarsanaa.
Die Forderung nach einer Abberufung wegen Kompetenzüberschreitung und Verletzung
der Rechte der Staatsversammlung und ihres Vorsitzenden war vom Obersten Gericht
der Mongolei erhoben und von einer Mehrheit im Justizausschuss unterstützt
worden.
Am Nachmittag des selben Tages erklärte der Vorsitzende der Großen
Staatsversammlung Z. Enkhbold die Sondersitzung für beendet, nachdem er in
seiner Abschlussrede auf die getroffenen Entscheidungen (Rechte der Kinder,
Rechte von Menschen mit Behinderungen, Verwaltungsrecht u. a.) hingewiesen
hatte.
Arbeitsgesetz und andere Gesetzentwürfe bzw. Änderungen, Zusätze und Beschlüsse
würden in den Frühjahrssitzungen behandelt werden.
Außenminister
Purevsuren auf Münchner Sicherheitskonferenz
Außenminister Lundegiin Purevsuren
hat die Mongolei auf der 52. Sicherheitskonferenz vom 12. bis zum 14. Februar in
München vertreten.
Regierungschefs aus 30 Ländern, Außenminister und Verteidigungsminister aus 60
Ländern sowie Vertreter der EU und der NATO waren der Einladung der
Organisatoren gefolgt.
Purevsuren nutzte die Gelegenheit mit seinen europäischen Amtskollegen über die
Vorbereitung des ASEM-Gipfels im Juli in Ulaanbaatar Erfahrungen auszutauschen.
Im Mittelpunkt der Debatten standen in diesem Jahr die Terrorismusbekämpfung,
die Flüchtlingskrise, die Kriege im Nahen Osten sowie die Möglichkeiten, diese
Kriege unter Führung der USA und Russlands einzudämmen.
Ebenfalls ein wichtiges Thema, der Einfluss der chinesischen
Wirtschaftsentwicklung auf die Weltwirtschaft.
Vertrag über
Rückgabe von Kulturgütern unterzeichnet
Die Mongolei und die USA haben im
Rahmen ihrer Regierungszusammenarbeit ein Abkommen unterzeichnet, das die
Rückgabe von illegal in die USA verbrachten wertvollen archäologische,
historischen und kulturellen Gütern mongolischer Herkunft an die Mongolei
regelt.
Am 04. Februar hatte der mongolische Botschafter in den USA B. Altangerel seine
Unterschrift unter das Dokument gesetzt.
Damit sollen langwierige Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit derartigen
Artefakten ausgeschlossen werden.
In der Hauptsache geht es um Dinosaurierknochen und versteinerte Sauriereier,
die in verschiedenen US-Bundesstaaten sichergestellt werden konnten.
„Gläserne Konten"
Am 15. Februar hat die
Antikorruptionskommission darüber informiert, dass 38.900 oder 98,5 Prozent der
vom Gesetzgeber dazu verpflichteten Personen – hohe Staatsangestellt, Mitglieder
der Großen Staatsversammlung und politische Würdenträger - ihre Einkommen
offengelegt hätten.
Von vier Personen fehlten diese Angaben bisher.
Im vergangenen Jahr hatten 38.400 Staatsangestellte, Abgeordnete und hohe
politische Beamte ihre Einkommensverhältnisse offengelegt, das entsprach 99,9
Prozent der dazu verpflichteten Personen.
Lediglich B. Sosorbaram und B. Tsendoo vom Nationalen Rundfunk- und Fernsehrat
hatten sich geweigert.
Bis Ende März haben die Säumigen noch die Gelegenheit, ihrer
Rechenschaftspflicht nachzukommen.
Dann werden die Namen und die Einkommensverhältnisse der Öffentlichkeit
vorgelegt.
„Jobfair 2016"
Am 25. und 26. Februar organisiert
die „Mongolisch-Deutsche Brücke" (MDB) zum siebten Mal die
Stellenvermittlungsbörse „Jobfair 2016: Start Youri Career".
Ort: Galerie für Moderne Mongolische Kunst in Ulaanbaatar.
Die Teilnahme- und Standgebühren betragen 250.000 Tugrug für beide Tage.
Anmeldungen können Sie sich direkt bei:
Otgonbayar Ulaankhuu, MDB.
E-Mail: info@mdb.mn
Tel.: +976 11 315990
Mobil: +976 98102040
Gewalt in der
Familie
Eine von zehn Frauen wird
Opfer von häuslicher Gewalt.
Polizei und Sozialministerium haben am 19. Februar über die Situation in den
betroffenen Familien, über Vorbeugungs- und Schutzmaßnahmen informiert.
90 Prozent der Opfer häuslicher Gewalt seien Frauen, 40 Prozent Kinder, aber
auch alte Leute (14 Prozent) seien betroffen.
In den vergangenen Jahren seien diese Straftaten um 60 Prozent gestiegen.
Dies hänge jedoch mit der erhöhten Aufmerksamkeit von Nachbarn und den
zuständigen Ämtern zusammen, so dass die Zahl der Anzeigen zugenommen hätte, so
ein Polizeisprecher.
30 Prozent der Gewalttäter verfügten über Hochschulbildung, 30 Prozent seien
arbeitslos. Insgesamt müsste konstatiert werden, die Täter stammten aus allen
gesellschaftlichen Schichten.
Infolge häuslicher Gewalt sind im vergangenen Jahr 638 Menschen in ihrer
Gesundheit beeinträchtigt worden, 12 Menschen starben.
57 Prozent der Straftaten würden in Ulaanbaatar, 43 in den Aimags begangen.
In den seit zwei Jahren neben einigen Polizeidienststellen bestehenden
„Frauenhäusern" hätten bisher 259 Frauen, 529 Kinder und fünf Männer
vorübergehend Schutz gesucht.

Naturkundemuseum
Neubau für
Naturkundemuseum?
Das einsturzgefährdete Gebäude des
Naturkundemuseums im Herzen der mongolischen Hauptstadt muss wahrscheinlich
abgerissen werden.
Für einen Neubau plant das Kulturministerium mit Kosten von 24 Milliarden Tugrug.
Das neue Gebäude soll mit sieben Stockwerken Asiens größtes Naturkundemuseum
werden.
Die Erarbeitung des Modells hätte 350 Millionen Tugrug gekostet.
Trotzdem hätte die Große Staatsversammlung bislang noch keine Entscheidung über
das Projekt getroffen.
Ministerium und Museumsführung hätten vorgeschlagen, neben Mitteln aus dem
Staatshaushalt, internationale Kredite zu verwenden.
Schreiben an internationale Organisationen seien allerdings bisher noch nicht
beantwortet worden.
„Unsere größten Hoffnungen ruhen auf der japanischen Organisation für
internationale Zusammenarbeit".
Museumsdirektor N. Zorigtbaatar weist auf die Anziehungskraft des Museums auf
ausländische Touristen hin.
Jährlich besuchten 60 – 120.000 Gäste das Museum.
Die wertvollen Ausstellungsstücke, die einen hervorragenden Eindruck von der
mongolischen Flora und Fauna vermittelten, zögen von allen Museen die meisten
Besucher an.
Von den 14.000 Ausstellungsstücken müssten viele im Depot gelagert werden, da
der Platz seit langem nicht ausreichte.
Erst im vergangenen Jahr hätten mongolische und koreanische Wissenschaftler 700
neue Funde dem Museum übereignet.
125.00 Mongolen
leben und arbeiten im Ausland
Beim regulären Pressegespräch im
Außenministerium informierte Außenminister L. Purevsuren u. a. über die Folgen
der Einreiseerleichterungen für mongolische Staatsbürger nach Südkorea.
Vor dem Inkrafttreten der Erleichterungen im April 2015 hätten durchschnittlich
zehn mongolische Bürger die Visumsfrist überzogen, danach sei diese Zahl auf 270
bis 300 gestiegen.
Mongolen, die in Österreich um Asyl gebeten hätten, sei dies verwehrt worden.
Sie sollen aus Österreich abgeschoben worden.
Bisher sei allerdings kein mongolischer Staatsbürger offiziell des Landes
verwiesen worden.
In Österreich lebten etwa 2.500 mongolische Bürger.
Laut Statistik lebten und arbeiteten 125.000 mongolische Staatsbürger in 58
Staaten, davon 33.172 offiziell.
In den letzten Jahren hätten Eheschließungen zwischen 20-30-jährigen Mongolinnen
und Ausländern stark zugenommen.
Allein im Januar 2016 hätten 1.070 Mongolen, davon 90 Prozent Frauen, einen
Ausländer, eine Ausländerin geheiratet.

Philip Hallay
„Meine Kühe fressen
nur Gras …
… keinen Müll". Das hätte man
befürchten müssen, wenn man die sieben Rinder von Begsuren inmitten von
Müllbergen am Grashang unterhalb des Gandanklosters beobachtete.
Nein, der ehemalige Bibliothekar und jetzige Viehhalter aus Leidenschaft
Begsuren lachte und meinte, die Kühe suchten sich nur das Gemüse heraus, dafür
würden sie sogar Tüten „öffnen".
Drehbuchautor (gemeinsam mit Christian Spieß) und Regisseur Philip Hallay
präsentierte am 19. Februar im Haus der Demokratie und Menschenrechte in Berlin
seinen Dokumentarfilm „Wo das Gras am höchsten wächst".
Organisiert worden war die Veranstaltung von „Maidar e. V." „Nomad Citizens" und
„Art Objective".

Wo das Gras am höchsten wächst
In seiner
Eröffnungsrede versprach der Leiter der Konsularabteilung der mongolischen
Botschaft in Berlin Ts. Batmunkh weitere Unterstützung für ähnliche Projekte und
lobte die sehr aktiven Auslandsmongolen für ihr Engagement.
Der Film entstand 2013 in der Mongolei als Bachelor-Arbeit des jungen
Filmemachers.
Neben Begsuren „Wir können nicht nur Vieh halten. Wir wissen auch was ein iPod
ist und wie es funktioniert", sorgten auch der Viehhalter Dalai aus dem
Zentralaimag und Deutschlandkenner Bat-Orgil Dash, der u. a. für die kongeniale
Übersetzung verantwortlich zeichnete, dafür, dass der Film ein authentisches
Bild vom Leben in der Mongolei, den Träumen und Zielen ihrer Menschen
vermittelt.
Hallay, der zum ersten Mal in der Mongolei, zum ersten Mal in Asien überhaupt
weilte, meinte, am schwierigsten sei eine Auswahl des Themas gewesen. „Für mich
war alles interessant und faszinierend".
Die Mongolei ist ein Land mit Problemen, aber auch mit viel Hoffnung.
Die Reaktionen auf den Film waren sowohl seitens des deutschen als auch des
mongolischen Publikums überaus positiv.
Im zweiten Teil der Veranstaltung spielten Mitglieder von „Transmongolia"
gewohnt gekonnt auf der Pferdekopfgeige und begeisterten die Besucher mit ihren
Khumiigesängen.

M. Mentel, P. Wensierski
„Die verbotene
Reise"
Am 20. Februar hatte die
mongolische Botschaft zur Buchlesung „Die verbotene Reise – Geschichte einer
abenteuerlichen Flucht" in die Räume am Hausvogteiplatz in Berlin geladen.
Im Buch schildert der Spiegelredakteur und Schriftsteller Peter Wensierski die
Erlebnisse zweier DDR-Studenten auf ihrer Reise durch Polen, die Sowjetunion,
die Mongolei und China im Jahr 1987.
Anwesend waren nicht nur der Autor, sondern auch Marion („Marie") Mentel, die
mit ihrem damaligen Freund, dem Biologiestudenten Jens diese abenteuerliche
Reise nach Asien unternahm.
Der Autor und seine Protagonistin schildern die Situation in der damaligen DDR,
die Mühen der Vorbereitung – Beschaffung von Reisedokumenten, Fotoausrüstung,
passenden Schuhen, Rucksäcken …- und die schließlich geglückten
Grenzüberschreitungen, die Begegnungen mit russischen Grenzsoldaten,
mongolischen Nomaden und chinesischen Mönchen.
Solongo Treml hat die sehr gut besuchte Veranstaltung organisiert.
Die musikalische Umrahmung übernahmen Jamba Gereltsogt und Nemekhbayar Yadmaa
von „Transmongolia" und die Musikerin Uuganaa Buren-Amar, die auf ihrem Cello
ein Stück aus dem mongolischen Kinoerfolg „Mandkhai, die Kluge" vortrug.

B. Uuganaa
Fotos, wenn nichts
anderes vermerkt, Renate Bormann